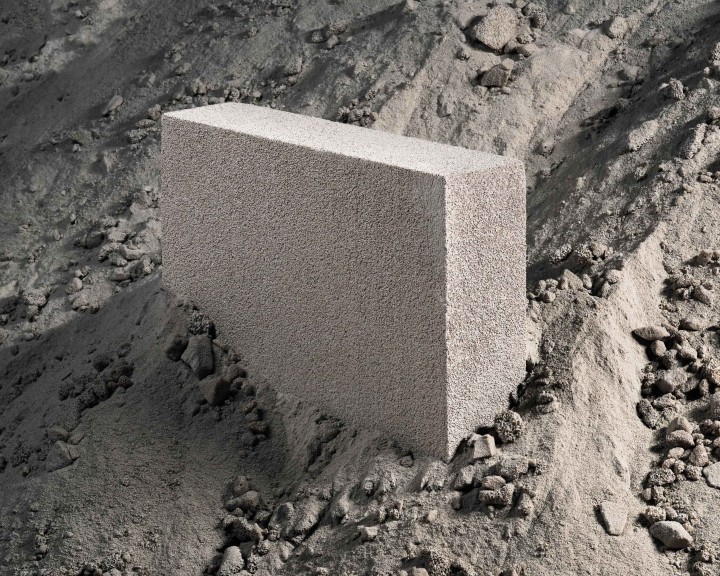«Am besten auf Baumaterialien setzen, die eine saubere und einfache Wiederverwendung ermöglichen»
Recycling und Kreislaufwirtschaft im Bauwesen werden zukünftig an Bedeutung gewinnen, sagt Susanne Kytzia. Die Professorin am Institut für Bau und Umwelt an der Ostschweizer Fachhochschule spricht im Interview über die damit verbundenen Herausforderungen und Chancen. Sie gibt konkrete Tipps für Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer, wie sie beim Bauen und Renovieren ressourcenschonend vorgehen können.
Susanne Kytzia, viele Menschen denken bei Recycling vor allem an Glas oder PET. Was bedeutet Recycling konkret im Baukontext?
Das kann man sich ganz ähnlich vorstellen wie beim Recycling im Haushalt: Wenn ein Haus abgerissen wird, stellt das Bauunternehmen verschiedene Mulden auf die Baustelle und führt den Rückbau so durch, dass die Materialien möglichst sortenrein getrennt werden – also so, wie wir zuhause Glas und PET trennen. Je besser diese Trennung gelingt, desto günstiger ist am Ende auch die Entsorgung. Wenn ich zum Beispiel Betonabbruch sauber trennen kann, ist das praktisch kostenneutral. Befinden sich jedoch andere Stoffe darin, wird die Entsorgung entsprechend teurer. Gelingt es sogar, Armierungseisen oder Armierungsstangen direkt auf der Baustelle zu separieren, kann man dafür mitunter sogar Geld bekommen. Insofern ist das Prinzip dem Recycling im Haushalt sehr ähnlich: Wer sauber trennt, spart oder verdient sogar etwas.
Welche Rolle spielt der Gebäudesektor in Sachen Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft?
Der Gebäudesektor spielt eine sehr wichtige Rolle, wenn es um Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft geht, denn die Bauwirtschaft ist mit enormen Mengenströmen verbunden. Es werden riesige Mengen an Materialien bewegt – etwa Kies, Beton, Asphalt oder auch Aushubmaterial aus Baugruben, sei es verschmutzt oder nicht. Allein schon wegen dieser Menge macht dieser Bereich den grössten Teil des gesamten Abfallaufkommens beim Abbruch aus. Dabei handelt es sich in der Regel nicht um besonders giftige Abfälle, sondern einfach um eine grosse Masse, die transportiert und entsorgt werden muss – oft über Deponien. Die meisten dieser Materialien werden nicht verbrannt, sondern in einen anderen Nutzungskreislauf überführt – man spricht hier von «Downcycling». Das alles bedeutet grosse Transportvolumina, die wiederum Umweltbelastungen verursachen – etwa durch Lärm, Abgase oder Staub.
Gibt es in der Schweiz gesetzliche Vorschriften oder Anreize – zum Beispiel besondere Förderungen –, die das Thema Recycling und Kreislaufwirtschaft im Bau vorantreiben?
Ja, in der Schweiz gibt es durchaus gesetzliche Vorgaben, die Recycling und Kreislaufwirtschaft im Bau vorantreiben – insbesondere seit Inkrafttreten der Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen, kurz VVEA, im Januar 2016. Diese regelt den Umgang mit Bauabfällen relativ streng. So gilt etwa ein Verwertungsgebot für bestimmte Bauabfälle, beispielsweise Betonabbruch, was bedeutet, dass sie wiederverwertet werden sollen. Für die Entsorgung von grösseren Bauvorhaben ab 200 Kubikmeter Bauabfall muss ein Entsorgungsnachweis erbracht werden. Das hat zur Folge, dass zukünftig deutlich weniger Bau- und Aushubdeponien bewilligen wird. Dadurch wird das Deponieren deutlich teurer – und genau das schafft einen finanziellen Anreiz, möglichst gut zu trennen und wiederzuverwerten, um die hohen Deponiegebühren zu vermeiden.
Du hast den Verwertungsnachweis angesprochen – wer muss diesen erbringen?
Den Entsorgungsnachweis muss die Bauherrin beziehungsweise der Bauherr erbringen. Alles, was mit der Baubewilligung und den gesetzlichen Vorgaben zusammenhängt, liegt in ihrer beziehungsweise seiner Verantwortung. Das bedeutet: Sie oder er muss nachweisen, wie die anfallenden Bauabfälle gemäss VVEA verwertet beziehungsweise entsorgt werden. Für weitere Informationen zum Entsorgungsnachweis kann man sich an die Baubehörde des Wohnorts wenden.
Gut geplant ist halb saniert
Bei der Sanierung deines Eigenheims spielt der Versicherungsaspekt eine wichtige Rolle. Ein Experte verschafft dir einen Überblick über die verschiedenen Versicherungen und sagt, wann sich diese rentieren.
Welche Gründe sprechen dafür, sich als Hauseigentümerin oder als Hauseigentümer mit dem Thema Recycling im Bau auseinanderzusetzen?
Ein wichtiger Grund, sich als Hauseigentümerin oder Hauseigentümer mit dem Thema Recycling im Bau auseinanderzusetzen, liegt darin, dass heute in der Schweiz die meisten Bauprojekte entweder Erweiterungen bestehender Gebäude oder Ersatzneubauten sind. Das Bauen auf der grünen Wiese ist eher zur Ausnahme geworden. In vielen Fällen bedeutet das: Bevor ich etwas Neues bauen kann, muss ich zuerst etwas Bestehendes zurückbauen – und genau dabei wird die Verwertung von Bauabfällen zum Thema. Denn wie gut ich diese Abfälle trennen und verwerten kann, hat direkte Auswirkungen auf die Kosten. Das ist ganz konkret spürbar. Auf lange Sicht lohnt es sich also, beim Bauen darauf zu achten, dass man später beim Umbauen oder Abreissen keine hohen Kosten für Entsorgung oder Recycling hat.
Gibt es ein Beispiel, das aufzeigt, warum es sinnvoll ist, sich schon frühzeitig mit den Kosten für Recycling und Entsorgung zu beschäftigen?
Wir haben unser Haus damals mit einer modernen, aufgeklebten Dämmung aus Kunststoff dämmen lassen – rund 15 Zentimeter stark, auf der gesamten Fassade. Sollten wir das irgendwann zurückbauen müssen, wäre das sehr teuer. Hätten wir das vor 15 oder 20 Jahren so bedacht, hätten wir uns vermutlich gegen dieses System entschieden. Viele denken beim Bauen nicht an den Rückbau, sondern hoffen, dass alles ewig hält. Doch irgendwann kommt dieser Moment – und dann können solche Entscheidungen das nächste Bauprojekt erheblich verteuern.
Aktuell wirkt sich das noch nicht auf den Gebäudewert aus, da dieser in erster Linie durch den Immobilienwert und damit stark durch die Lage bestimmt wird. Aber langfristig könnte auch der Gebäudewert sinken – etwa dann, wenn potenzielle Käuferinnen oder Käufer erkennen, welche Kosten in Zukunft auf sie zukommen.
So kannst du die Kreislaufwirtschaft unterstützen
Was die Kreislaufwirtschaft im Bauwesen auszeichnet und wie du diese bei deinem eigenen Sanierungsprojekt unterstützen kannst.
Über die Gründe, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, haben wir bereits gesprochen. Gibt es nun aber auch Nachteile, die man im Auge behalten sollte?
Wenn ich mich heute als Bauherrin oder Bauherr bewusst mit dem Thema Rückbaubarkeit und Trennbarkeit von Baustoffen auseinandersetze, kann das zunächst mit höheren Kosten verbunden sein. Auch wenn klar ist, dass ich in 20 oder 30 Jahren dadurch Geld sparen werde, ist der Aufwand im Moment erst einmal höher aufgrund der aufwendigeren Planung, spezieller Materialien und höherer Anfangsinvestitionen. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt, über den man nachdenken sollte.
Ein weiterer Punkt betrifft die Wiederverwertung der heute anfallenden Bauabfälle: Je nach Material kann das Recycling mit einem höheren Ressourcenverbrauch oder höheren Emissionen verbunden sein als die Neuproduktion. Besonders beim Beton ist das der Fall – dort bringt Recycling vergleichsweise wenig für den Klimaschutz – auch wenn RC-Beton andere ökologische Vorteile hat. Anders sieht es bei Metallen aus: Hier ist das Rezyklieren fast immer umweltfreundlicher und kostengünstiger. Für mich als Bauherrin oder Bauherr hat das allerdings nur bedingt Auswirkungen – zumindest finanziell. Relevant wird es vor allem dann, wenn ich auch ökologische Verantwortung übernehmen möchte.
Gibt es bestimmte Baumaterialien oder Bauweisen, die besonders empfehlenswert sind, wenn ich auf Langlebigkeit und spätere Wiederverwertung achten will?
Negativ formuliert sollte man Baumaterialien und Bauweisen vermeiden, bei denen die einzelnen Bestandteile verklebt oder fest miteinander verbunden sind und sich schwer trennen lassen. Verbundmaterialien mit mehreren Schichten sind daher meist weniger geeignet. Ein gutes Beispiel ist die aufgeklebte Dämmung, die wir zuvor erwähnt haben – das ist sicher nicht die cleverste Art zu bauen. Viel sinnvoller ist es, Materialien so auszuwählen und zu verarbeiten, dass sie sich später gut trennen lassen. Mechanische Verbindungen ohne Klebstoffe sind deshalb meist besser. Auch beim Holzbau ist es vorteilhaft, wenn man auf Behandlungen oder Beschichtungen verzichtet, die das Material schwer wiederverwertbar machen. Grundsätzlich gilt: Alles, was eine saubere und einfache Wiederverwendung ermöglicht, ist langfristig gesehen die bessere Wahl.
Reportage: So sieht ökologisches Dämmen in der Praxis aus
Dämmplatten aus recyceltem Baugruben-Material, ein Dämmstoff aus gezüchteten Pilzfasern oder pflanzliches Isolationsmaterial, das CO2 dauerhaft bindet – nur drei aktuelle Trends.
Hast du weitere konkrete Tipps für Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer, die ressourcenschonend bauen, renovieren oder zurückbauen möchten?
Ein ganz einfacher Tipp ist: Wenn möglich, sollte man nicht neu bauen, sondern den bestehenden Bestand erhalten und erweitern. So spart man sich den ganzen Rückbau und die damit verbundenen Probleme. Generell gilt: Wenn man viel unterkellern muss und grosse Betonmengen verbaut, ist das aus Ressourcensicht das Ungünstigste, was man tun kann. Wenn sich das vermeiden lässt, sollte man zumindest den Betonanteil möglichst gering halten und bei anderen Bauteilen auf alternative Materialien setzen. Ausserdem ist es immer empfehlenswert, das Haus von Anfang an so zu planen, dass die Grundrisse möglichst flexibel sind und eine langfristige Nutzung möglich ist. So baut man nicht nur für die nächsten Jahrzehnte, sondern vielleicht für mehr als hundert Jahre. Damit muss die Nachfolgerin oder der Nachfolger das Haus nicht gleich wieder abreissen, nur weil die Grundrisse nicht mehr passen.
Wenn du sagst, die Grundrisse sollen möglichst flexibel sein – wie kann man sich das in der Praxis vorstellen?
Was man vor allem bei grösseren Häusern tun kann, ist, möglichst wenige tragende Wände einzubauen oder diese so zu planen, dass viele unterschiedliche Raumaufteilungen möglich sind. So können Zwischenwände flexibel gesetzt und verändert werden. Auch die Erschliessung des Gebäudes sollte so gestaltet sein, dass sie später umgebaut werden kann. Zum Beispiel kann man das Obergeschoss getrennt vermieten oder unterschiedliche Zugänge schaffen, sodass man nicht an einen starren Grundriss gebunden ist, der nur so funktioniert, wie er ursprünglich gebaut wurde.
Wagen wir als Abschluss einen Ausblick in die Zukunft: Welche Bedeutung wird Kreislaufwirtschaft im Bauen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten zukommen?
Ich denke, die Kreislaufwirtschaft im Bauwesen wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten eine immer grössere Bedeutung gewinnen. Die neue Abfallgesetzgebung, insbesondere die zu Beginn angesprochene VVEA, greift jetzt erst richtig, und die Kosten für die Entsorgung auf Deponien steigen zunehmend. Zudem wird der verfügbare Deponieraum, je nach Kanton, immer knapper, was die Preise weiter nach oben treibt. Gleichzeitig verschärfen sich auch die Umweltvorschriften, etwa im Umgang mit Schadstoffen. Wenn man zum Beispiel in dicht besiedelten Gebieten Aushubmaterial abträgt, wird es zunehmend schwieriger, sauberen und unbelasteten Aushub zu gewinnen. Dadurch steigen die Deponiekosten, weil das Material nicht mehr so gut wieder verwendet werden kann. Diese Entwicklung erhöht den Kostendruck beim Rückbau. Gleichzeitig eröffnet sich aber auch eine grosse Chance: Wer durch sorgfältige Trennung und rückbaufreundliche Bauweisen die Recyclingfähigkeit der Materialien verbessert, kann hohe Entsorgungskosten vermeiden und langfristig Geld sparen.
Ein weiterer wichtiger Faktor, dessen Entwicklung noch schwer abzuschätzen ist, betrifft die Rohstoffseite: Es bleibt offen, wie sich die Preise für Rohstoffe zukünftig entwickeln werden. Bereits heute ist bei Metallen wie Kupfer oder Stahl zu beobachten, dass die Preise steigen. Beim Beton hingegen geht die Entwicklung eher in die entgegengesetzte Richtung. Wie sich das in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren entwickelt, ist heute allerdings schwer vorherzusagen.
Expertin im Interview: Susanne Kytzia
Susanne Kytzia ist Professorin am Institut für Bau und Umwelt an der Ostschweizer Fachhochschule und dort Leiterin des Interdisziplinären Schwerpunkts «Climate and Energy».
Dein myky-Dossier
Mit deinem myky-Dossier sparst du Zeit, Energie und Kosten. Registriere dich jetzt und nutze viele nützliche Tools und Funktionen, wie zum Beispiel:
- Solarpotenzial berechnen
- Sanierungsplan erstellen
- Dokumente ablegen
- Experten finden
- Projekte planen